

Meine erste Frage lautete, ob die Begriffssysteme die Textstruktur
beeinflussen und ob man sie in der Textstruktur sehen kann. Obgleich
Enzyklopädieartikel auf den ersten Blick strukturell ähnlich
aussehen, scheint es mir bei näherer Betrachtung Unterschiede
zwischen ihnen je nach Art des behandelten Gegenstandes, des Enzyklopädietyps, des Umfangs der Enzyklopädie und dem Artikelschreiber zu
geben. In einigen Artikeln ist eine sehr deutliche Einteilung
in Teiltexten zu sehen, was oft z.B. in Überschriften, mit
der Numerierung und Abschnittgliederung noch hervorgehoben gemacht
wird. In anderen Fällen hat man vielleicht alle Aspekte des
behandelten Themas in einer Textsequenz zusammengebunden.
Lothar Hoffmann, der Enzyklopädieartikel und ihre Makrostruktur
untersucht hat, beantwortet schon teilweise meine Fragen, wenn
er konstatiert (1988: 167): "die Makrostruktur des Fachtextes
entspringt und entspricht in hohem Maße der Struktur des
in ihm behandelten Gegenstandes, aus der sich eine Art 'innere
Logik' ergibt, der sich letztlich auch die Absicht des Textverfassers
unterzuordnen hat." Der Artikel, der ein "Erzeugnis
der materiellen Produktion" behandelt, kann nach Hoffmann
z.B. folgende hierarchische Abhängigkeitsbeziehungen zwischen
den Teiltexten enthalten:
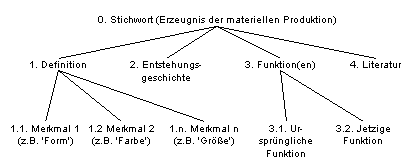
Auch in den Isotopiekettenuntersuchungen hat man feststellen können,
daß ein Enzyklopädieartikel "stark auf eine Darstellung
des durch das Stichwort repräsentierten Themas orientiert"
ist, "was sich explizit durch einen großen Anteil der
Isotopieelemente an der Textoberfläche äußert"
(Wiegand 1987: 151). In meinem Material haben die meisten Artikel
deutlich eine hierarchische Struktur wie oben angeführt,
z.B.[4]:
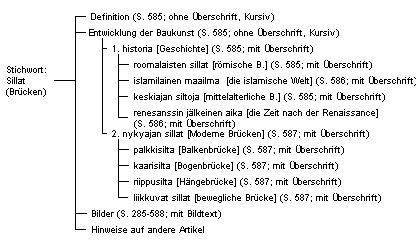
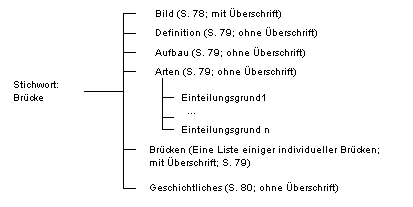
In den o.g. Hierarchien meiner Fallstudie waren die wichtigsten
Konstituenten diejenigen, die Arten und Gattungen behandeln, da
genau sie die Abstraktionssysteme beschreiben. Ihre Strukturen
sind häufig sehr stark von den Begriffssystemen beeinflußt.
Wenn Enzyklopädieartikel Allgemeinbegriffe beschreiben -
also nicht Personen, Länder usw., die auch häufig in
Enzyklopädien berücksichtigt werden - haben sie oft
eine deduktive Struktur. Man fängt mit dem Begriff an, der
durch das Stichwort repräsentiert ist; hinsichtlich der Merkmale
wird man zwischen den verschiedenen Unterbegriffen unterscheiden
und so weiter, oftmals bis zu ganz konkreten Beispielen. Solche
Artikel können das Abstraktionssystem einfach in Listenform
mit kurzen Begriffsbeschreibungen oder in systematischer Folge
mit längeren Teiltexten darstellen.
Auch die anderen Begriffssysteme können diesen Texttyp beeinflussen,
z.B. partitive Systeme und temporale Systeme (die aus zeitliche
Beziehungen bestehen), wenn man die Teile eines Objekts beziehungsweise
Phasen eines Prozesses beschreibt.
